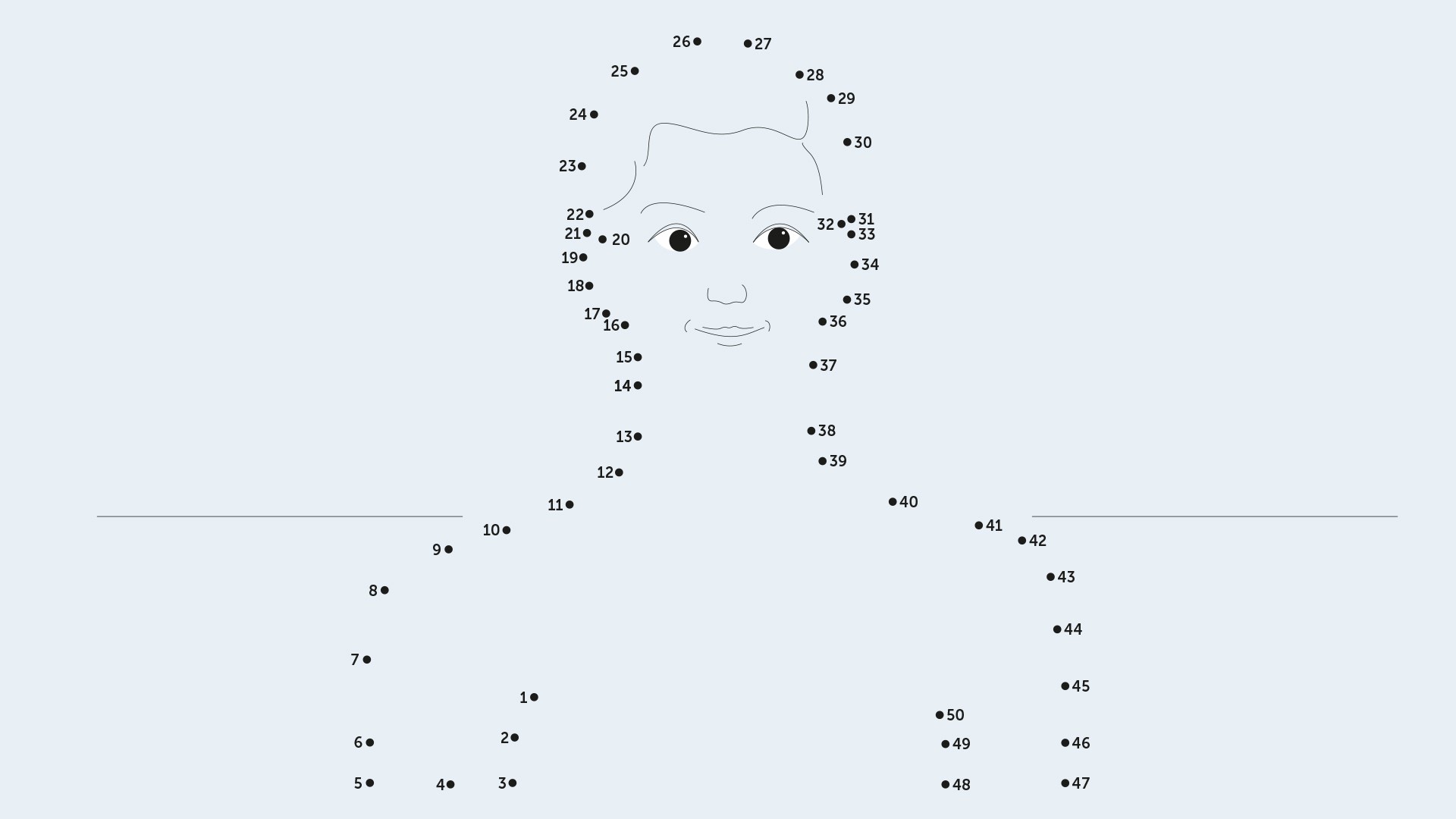Viele Punkte, wenig Wirkung? Die Tücken eines Zuwanderungssystems à la Australien
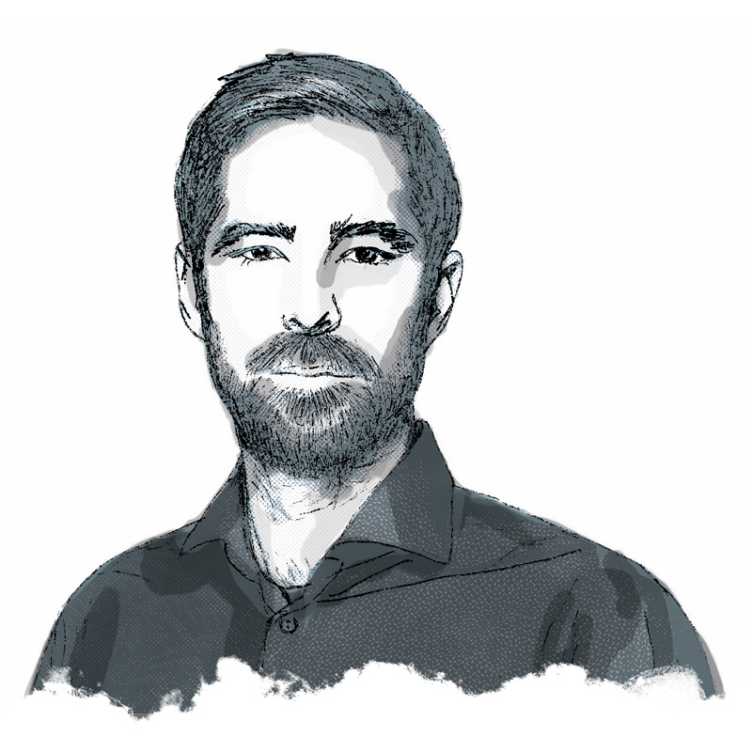
Kaum ein Thema wird in der Schweiz so emotional und kontrovers diskutiert wie die Zuwanderung und ihre Steuerung. Könnte ein Punktesystem à la Australien und Kanada die Lösung sein? Eine Analyse vom KOF-Arbeitsmarktökonomen Michael Siegenthaler.
In Zeiten von Arbeitskräftemangel und dem Ruf nach mehr Kontrolle über die Migration fordern manche Stimmen, dass die Schweiz ein Punktesystem à la Australien und Kanada für die Zuwanderung einführen soll. Die Idee klingt verlockend: Künftig wird anhand objektiver Kriterien bestimmt, welche Zuwanderer und Zuwanderinnen ins Land gelassen werden und welche nicht. Interessierte Personen erhalten Punkte, basierend auf Kriterien wie ihrem Bildungsniveau, ihren Sprachkenntnissen und ihrer Berufserfahrung. Neben Australien und Kanada kennen etwa Neuseeland und seit dem Brexit auch Grossbritannien ein solches System. Die Ziele sind klar: Die Zuwanderung soll begrenzt und gleichzeitig auf Hochqualifizierte konzentriert werden, die sich in der Regel schneller integrieren und damit möglicherweise einen grösseren volkswirtschaftlichen Beitrag leisten.
«Ein System, in dem der Staat eine zentrale Rolle bei der Auswahl der Zuwanderer spielt, hat gerade für Unternehmen klare Nachteile gegenüber dem heutigen Zuwanderungssystem der Schweiz.»Michael Siegenthaler
In einem Policy Brief für Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen aus Politik, Behörden und Organisationen habe ich mich zusammen mit Professorin Santosh Jatrana, einer bekannten australischen Migrationsforscherin, die das australische Zulassungssystem aufgrund ihrer Forschung und aus eigener Erfahrung sehr gut kennt, mit den Vor- und Nachteilen von existierenden Punktesystemen auseinandergesetzt. Meine Erkenntnis aus dieser Zusammenarbeit war, dass ein solches System in mancher Hinsicht durchaus vorteilhaft ist: So ist es in einem Punktesystem weniger wahrscheinlich, dass es zu negativen Arbeitsmarkteffekten von Zuwanderung kommt. Das liegt daran, dass die zugewanderten Personen systembedingt eher eine Ergänzung zur einheimische Erwerbsbevölkerung darstellen und grosse Zuwanderungsschübe vermieden werden, welche die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts überfordern können. Ein gut durchdachtes Punktesystem trägt zudem zur Chancengleichheit und zur Transparenz von Einwanderungsentscheidungen bei, indem es für alle Bewerberinnen und Bewerber die gleichen Kriterien anwendet.
Doch ein System, in dem der Staat eine zentrale Rolle bei der Auswahl der Zuwandernden spielt, hat gerade für Unternehmen und möglicherweise auch für die Volkswirtschaft klare Nachteile gegenüber dem heutigen Zuwanderungssystem der Schweiz, in dem die Unternehmen und ihre Anstellungsentscheide die Zuwanderung steuern.
Dafür gibt es mindestens drei Gründe: Erstens ist es in der Praxis alles andere als einfach, die Auswahlkriterien des Systems an den tatsächlichen Beschäftigungsmöglichkeiten im Land auszurichten. So ist der Arbeitsmarkt dynamisch und Engpässe, die heute festgestellt werden, können morgen schon nicht mehr bestehen. Zudem ist es schwierig, die Komplexität des Arbeitskräftemangels abzubilden. Nicht immer ist ein ganzer Berufszweig von Arbeitskräftemangel betroffen. Oft fehlt es an Arbeitskräften mit einer bestimmten Kombination von Qualifikationen und Fähigkeiten, spezifischen Weiterbildungen oder bestimmten «soft skills», die sich kaum objektiv messen lassen. Schliesslich kann man Zuwandernden in einem Punktesystem nicht vorschreiben, wo sie sich niederlassen. Deshalb wandern sie möglicherweise nicht dorthin, wo der Bedarf am grössten ist.
«Die Wahrscheinlichkeit, dass Migranten und Migrantinnen in den ersten ein bis drei Jahren einen Job haben, ist in der Schweiz höher als in den meisten Ländern mit Punktesystem.»Michael Siegenthaler
Ein grosser Nachteil des Systems ist zweitens, dass die meisten Zugewanderten in Punktesystemen ohne Jobangebot einreisen. Zwar erhalten Migranten und Migrantinnen mit einem Arbeitsplatz in der Regel mehr Punkte, doch in der Realität ist der Prozess zu langwierig und zu unsicher, als dass viele Unternehmen den Kandidierenden ein Stellenangebot vor der Einreise unterbreiten würden. Die Konsequenz ist, dass Migranten und Migrantinnen in Punktesystemen nach der Einreise oft mit einer langwierigen Jobsuche, Unterbeschäftigung und Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Qualifikationen konfrontiert sind. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Migranten und Migrantinnen in den ersten ein bis drei Jahren nach der Einreise einen Job haben, in der Schweiz höher als in den meisten Ländern mit Punktesystemen.
Eine dritte Schwäche des Systems besteht darin, dass es den hohen Bedarf der Unternehmen an weniger qualifizierten Arbeitskräften – etwa in Branchen mit saisonalen oder kurzfristigen Nachfragespitzen – nur unzureichend deckt. Die Erfahrungen der Länder mit Punktesystemen zeigen, dass der Arbeitskräftemangel in diesen Bereichen trotz Punktesystem nicht verschwindet. Daher haben diese Länder zusätzliche Zuwanderungsprogramme für weniger qualifizierte Arbeitskräfte, z.B. Saisonarbeiterprogramme für die Landwirtschaft, den Tourismus und das Baugewerbe. Diese Programme helfen zwar, die Lücke an unqualifizierten Arbeitskräften zu schliessen, eröffnen aber meist auch Möglichkeiten für eine dauerhafte Einreise. Darüber hinaus schränken solche Programme häufig die Rechte der Arbeitsmigrierten ein, was – wie neuere Forschungen zeigen – negative Auswirkungen auf die einheimischen Arbeitskräfte haben kann, z.B. weil das Lohnniveau in einer Branche unter Druck gerät. Die Notwendigkeit, ein Punktesystem durch Zuwanderungsprogramme für weniger qualifizierte Arbeitskräfte zu ergänzen, birgt daher die Gefahr, dass die zentralen Ziele des Systems – die Zuwanderung zu begrenzen und auf Hochqualifizierte auszurichten – verfehlt werden.
Insgesamt gibt es also auch gewichtige Gründe, die gegen ein Punktesystem sprechen. Dass diese kein Allheilmittel sind und ihre Ziele auch verfehlen können, zeigte sich zuletzt auch in Grossbritannien. Hier ist die Zuwanderung nach der Einführung des Punktesystems gestiegen, nicht etwa gesunken.
Downloads
In einem externe Seite Policy Brief (in englischer Sprache) beleuchten Santosh Jatrana und Michael Siegenthaler die Vor- und Nachteile von punktebasierten Zuwanderungssystemen genauer.
Ansprechperson
KOF Konjunkturforschungsstelle
Leonhardstrasse 21
8092
Zürich
Schweiz