«Wir steuern auf eine vermachtete Wirtschaft zu»
Protektionismus und geopolitische Spannungen bedrohen den Welthandel. Deutschland reagiert mit einem Wachstumspaket, die amerikanische Notenbank Fed steckt in der Zwickmühle, die steht EU am Scheideweg. Die KOF Ökonomen Heiner Mikosch und Alexander Rathke diskutieren, was das alles für die Schweiz bedeutet, wo sie besonders verwundbar ist, was sie jetzt tun kann – und wer profitiert.
Interview: Daniel Ammann und Simon Brunner
Herr Mikosch, Herr Rathke, Totgeglaubte leben länger: Ein neuer Protektionismus erschüttert die Weltwirtschaft. Was sind die gravierendsten Folgen?
Mikosch: Ganz zentral ist der Verlust an Kaufkraft. Wenn Länder ihre Märkte abschotten, werden Güter teurer – das trifft alle. Hinzu kommt ein erheblicher Effizienzverlust, weil die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung reduziert werden.
Rathke: Genau. Kein Land kann alles selbst herstellen – bereits der Versuch, das zu tun, führt zu sinkender Produktivität, weniger Produktevielfalt und verminderter Innovationskraft. Und langfristig bedeutet das ganz klar: weniger Wohlstand.
Mikosch: Noch gravierender ist, dass sich die Spielregeln der Wirtschaft verändern. Es gewinnen nicht mehr diejenigen, die am effizientesten produzieren, sondern jene mit dem besten Zugang zur Politik. Wir steuern auf eine vermachtete Wirtschaft zu, in der politische Beziehungen wichtiger sind als Wettbewerbsfähigkeit. Wer seine Branche oder sein Land in Brüssel oder Washington absichern kann, hat gewonnen. Das lähmt Innovation zusätzlich und kann ganze Modernisierungsprozesse blockieren.
Wie wirkt sich die aktuelle Lage konkret auf die Schweiz aus?
Rathke: Die Unsicherheit überlagert alles. Investitionen werden aufgeschoben, Neueinstellungen ausgesetzt – niemand weiss, was morgen kommt, also wartet man lieber mal ab und tut nichts.
Mikosch: Besonders hart trifft es das verarbeitende Gewerbe. In dieser Branche arbeiten rund 700’000 Menschen. Sie war bereits unter Druck – nicht zuletzt wegen der anhaltenden Krise in der deutschen Automobilindustrie, mit der sie eng verflochten ist.
Rathke: Man muss aber klar sagen: Sollte der globale Protektionismus anhalten, wird er reale Einkommensverluste in der Schweiz hervorrufen – unabhängig von der Branche.
Was kann die Schweiz tun?
Mikosch: Drohen grössere Arbeitsausfälle, könnte der Bund die Kurzarbeit ausweiten, um temporäre Schocks abzufedern. Aber man muss aufpassen: Ab wann wird ein befristetes Instrument zur versteckten Dauersubvention? Genau da liegt die Gefahr.
Rathke: Handelspolitisch gilt es, langfristig möglichst viele Märkte zu erschliessen. Gleichzeitig muss man realistisch bleiben: Ein Freihandelsabkommen mit Vietnam oder den MERCOSUR-Staaten kann den privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt nicht ersetzen. Die Europäische Union bleibt unser wichtigster Handelspartner – das gilt es zu sichern.

«Unsere tiefe Staatsverschuldung ist ein strategischer Vorteil. Die Schweiz gilt als stabil.»Alexander Rathke
Sprechen wir also über die EU. Wie wird sie auf die aktuelle Lage reagieren?
Rathke: Zwei Szenarien sind denkbar: Entweder rückt sie enger zusammen – oder sie fällt auseinander. Beides ist möglich. Ich bin aber eher optimistisch. Stichwort deutsches Wachstumspaket: Das ist – zumindest potenziell – wachstumsstimulierend.
Potenziell?
Mikosch: Ein Teil des Pakets betrifft die Rüstungsausgaben. Die sind sicherheitspolitisch zentral, haben aber kaum positive Effekte auf die Gesamtwirtschaft. Man liest mitunter von Vergleichen mit dem Silicon Valley, das aus Militärausgaben hervorgegangen sei – es ist Wunschdenken, dass so etwas hier und jetzt geschieht.
Der andere Teil des Pakets betrifft Infrastrukturinvestitionen. Können die die Wirtschaft ankurbeln?
Mikosch: Durchaus. Deutschland hat grossen Nachholbedarf – im Verkehr, bei der Digitalisierung, aber auch beim Humankapital: Das Land investiert weniger in Bildung als der EU-Durchschnitt. Die Finanzierung der Infrastrukturinvestitionen über Schulden sehe ich allerdings kritisch.
Rathke: Werden die Mittel klug eingesetzt, kann das Wachstum durchaus stimuliert werden. Aber man darf nicht vergessen: Es handelt sich um eine Verschuldung – eine Wette auf die Zukunft.
Wird auch die Schweiz vom deutschen Fiskalpaket profitieren können?
Rathke: Ja, wenn die Konjunktur in Deutschland besser läuft, dann werden wir das auch hier merken. Gerade für das verarbeitende Gewerbe in der Schweiz ist Deutschland nach wie vor der Hauptabsatzmarkt.
Deutschland hat für das Wachstumspaket die Schuldenbremse gelockert – ist das auch für die Schweiz ein gangbarer Weg?
Mikosch: Nein. In Deutschland lässt sich die Finanzierung zumindest der Militärausgaben mit einer sicherheitspolitischen Notlage rechtfertigen. In der Schweiz sehe ich keinen vergleichbaren Notstand.
Rathke: Unsere tiefe Staatsverschuldung ist ein strategischer Vorteil. Die Schweiz gilt als stabil, verfügt im Ernstfall über grosse fiskalische Spielräume – und profitiert von tiefen Kapitalkosten...
…ist aber mit einer immer stärkeren Währung konfrontiert. Die Industrie leidet bereits. Eine weitere Aufwertung des Frankens dürfte die Lage verschärfen.
Mikosch: Ja, aber man darf nicht vergessen: Eine starke Währung hat auch Vorteile. Schweizer Industriebetriebe importieren viele Vorleistungen – Rohstoffe, Halbfertigprodukte – aus dem Ausland. Die werden mit einem starken Franken günstiger. Und auch die Konsumenten profitieren.
Wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) also nicht intervenieren?
Rathke: Früher hätte sie den Franken wohl geschwächt, um die Teuerung nicht unter null und damit ausserhalb des von der SNB als Preisstabilität definierten Bereichs fallen zu lassen. Heute ist das schwieriger, weil ihr die USA ja schon mal Währungsmanipulation vorwarf. Ich erwarte darum im Juni eher eine Zinssenkung – auch angesichts der drohenden wirtschaftlichen Abschwächung.
Dann wären wir wieder bei Nullzinsen angelangt. Ist das ein Problem, weil dann die SNB die Zinsen nicht mehr senken kann, ohne in den negativen Zinsbereich zu geraten?
Rathke: In der Vergangenheit hat die SNB ihre Geldpolitik im Wesentlichen auf zwei Instrumente gestützt: die Steuerung der kurzfristigen Zinsen und Interventionen am Devisenmarkt. Sollte eines dieser Instrumente nicht mehr im gewohnten Umfang zur Verfügung stehen, muss das verbleibende seine Funktion übernehmen. Allerdings gibt es auch bei den Zinsen eine effektive Untergrenze, ab der Anleger beginnen, ihr Geld von den Banken abzuziehen und stattdessen lieber in bar zu halten.

«Auch Trump weiss: Wenn er überzieht, schädigt das die US-Wirtschaft.»Heiner Mikosch
Und das amerikanische Pendant der SNB, die Federal Reserve (Fed)? Was wird sie tun?
Rathke: Die Fed steht unter grösserem Druck als die SNB. Ihr Auftrag umfasst neben Preisstabilität auch den Arbeitsmarkt. Dieses duale Mandat führt zu einem Dilemma: Um die Inflation zu bekämpfen, müsste sie die Zinsen erhöhen – um Jobs zu schaffen, müsste sie sie senken. Trump will eine Zinssenkung, damit die Beschäftigungszahlen steigen. Doch durch die hohen Einfuhrzölle ist auch der Inflationsdruck gewachsen. Wenn ich eine Prognose wagen müsste: Die US-Zinsen werden bis Jahresende nicht mehr stark sinken.
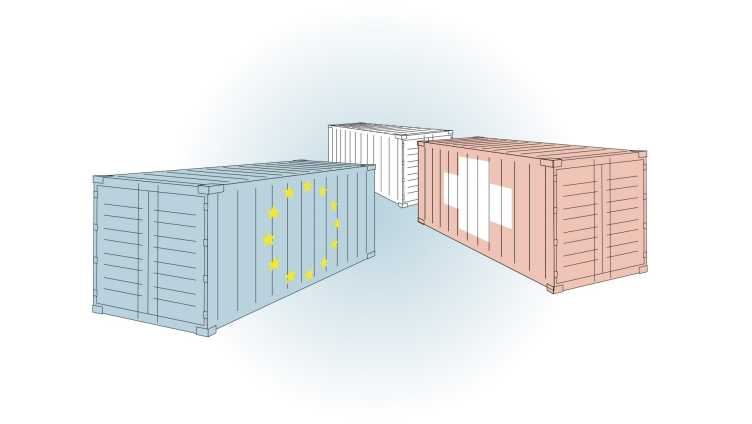
Am 9. Juli 2025 endet die 90-tägige Aussetzung der Einfuhrzölle durch Trump. Was geschieht danach?
Mikosch: Ich vermute, dass schliesslich nur ein Teil der Zölle tatsächlich eingeführt wird. Auch Trump weiss: Wenn er überzieht, schädigt das die US-Wirtschaft. Wahrscheinlich wird er die Zölle gezielt einsetzen – etwa gegen China oder bestimmte Branchen, die er zurück in die USA holen will. Ich fürchte, auch die Pharmaindustrie könnte betroffen sein…
Rathke: …und das würde die Schweiz empfindlich treffen. Pharma macht etwa die Hälfte unserer Exporte aus – und 23% davon gehen in die USA.
Gibt es auch Branchen in der Schweiz, die von der aktuellen Lage profitieren?
Rathke: Ja, etwa die Beratungsindustrie. Unternehmen müssen ihre Lieferketten neu denken, sich auf Zölle einstellen, komplexe Verrechnungspreise aufsetzen. Auch der Finanzsektor kann teils von höherer Volatilität profitieren – zumindest solange es nicht zu einem systemischen Crash kommt.
Zum Schluss: Der Protektionismus galt lange als überholt – warum feiert er jetzt ein Comeback, obwohl die Nachteile so offensichtlich sind?
Mikosch: Die ökonomische Doktrin, die seit Reagan und Thatcher vorherrscht, hat ihre sozialen Folgen lange ausgeblendet. Zwar haben der Abbau staatlicher Regulierung, die Öffnung der Märkte und die Liberalisierung von Handel und Kapitalströmen den weltweiten Wohlstand deutlich gesteigert. Doch dieses Modell hat auch klare Verlierer hervorgebracht. Und diese Verlierer rebellieren jetzt.
Rathke: Wer durch die Globalisierung seine Lebensgrundlage verloren hat – etwa ein Fliessbandarbeiter in Detroit oder ein Maschinenführer im Ruhrgebiet – lässt sich kaum von makroökonomischen Wohlstandszahlen trösten. Er will seinen Job zurück – und wählt die Politikerin oder den Politiker, die oder der ihm das verspricht.
Mikosch: Europa hat versucht, den sozialen Spannungen der Globalisierung entgegenzuwirken, etwa durch den Ausbau des Wohlfahrtsstaats. Die USA haben das nicht gemacht. Umverteilung zugunsten der Verlierer ist aber der Preis, den die liberale Seite zahlen muss, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftliche Offenheit zu bewahren.
Zur Person
Dr. Alexander Rathke studierte Volkswirtschaftslehre in München und leitet seit 2023 an der KOF die Sektion Schweizer Konjunktur. Seine Forschungsschwerpunkte sind Inflation und Geldpolitik, Wirtschaftsgeschichte sowie die Weiterentwicklung von Prognosemethoden.
Dr. Heiner Mikosch studierte Ökonomie, Philosophie und Politik. Nach Doktorat an der ETH Zürich arbeitet er seit 2012 an der KOF. Dort analysiert er das internationale Konjunkturumfeld der Schweiz, widmet sich dem KOF Nowcasting Lab und forscht zu makroökonomischen Prognosemethoden und Umfrageexperimenten. Seit 2024 präsidiert Heiner Mikosch die Vereinigung der Europäischen Wirtschaftsforschungsinstitute (AIECE).
Ansprechpersonen
KOF Konjunkturforschungsstelle
Leonhardstrasse 21
8092
Zürich
Schweiz
KOF Konjunkturforschungsstelle
Leonhardstrasse 21
8092
Zürich
Schweiz
