«Die Schweiz hat das Potenzial, sich zu einem globalen KI-Hub zu entwickeln»

Hans Gersbach, Co-Direktor der KOF, spricht über das Potenzial und die Risiken von Künstlicher Intelligenz und wie sich die Schweiz durch eine geschickte Regulierung als Technologiestandort positionieren kann.
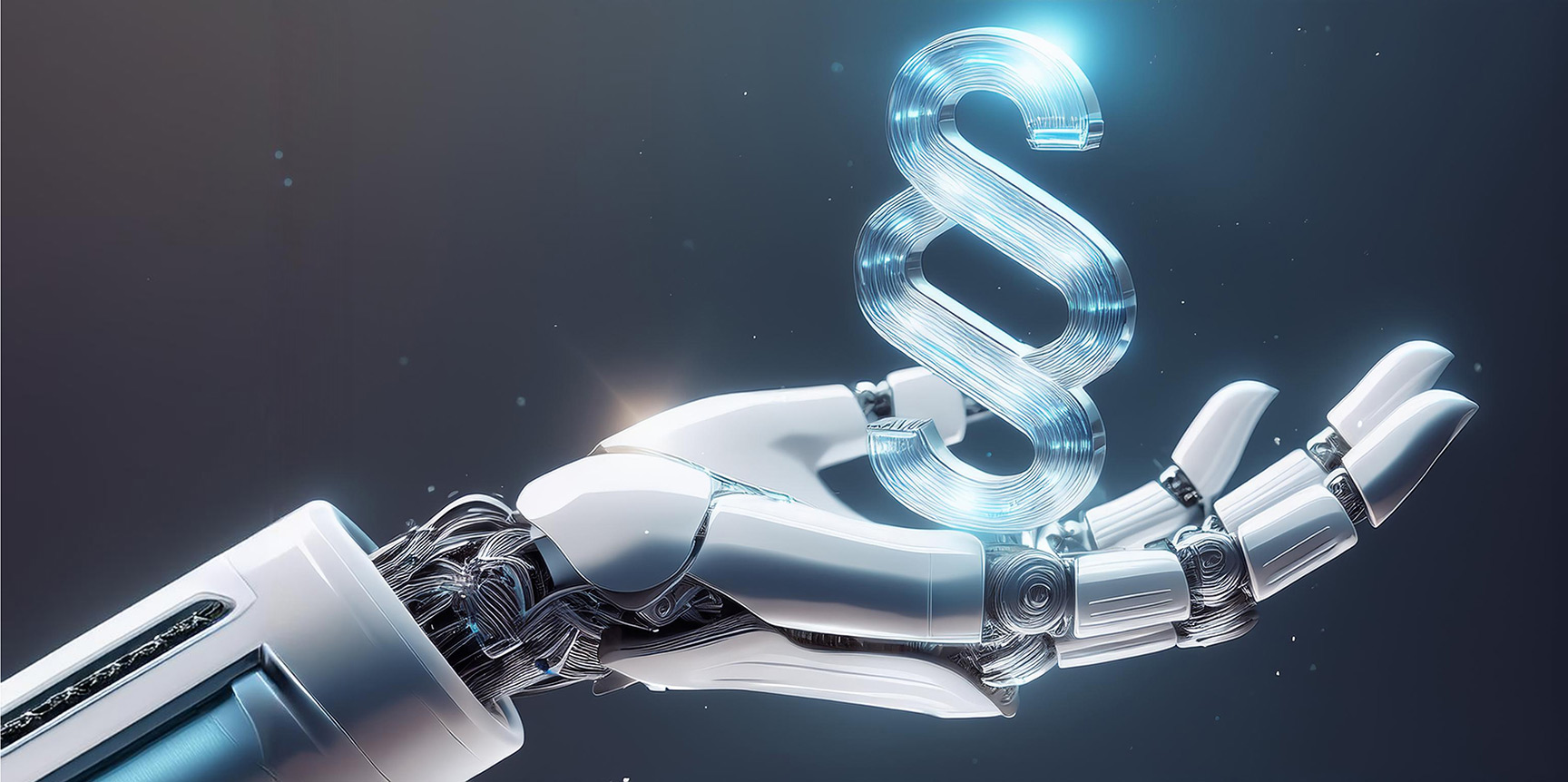
Ökonomen und Ökonominnen sind – zumindest dem Klischee nach – in der Regel für freie Märkte. Warum muss man die Künstliche Intelligenz (KI) überhaupt regulieren?
Ökonomen und Ökonominnen sind für freie Märkte, solange kein Schaden für Dritte entsteht und der Markt funktionstüchtig ist. Bei der KI können Probleme entstehen. Zudem können Grundrechte gefährdet werden. Auch ethische Erwägungen sprechen für eine Regulierung der KI.
«Wenn die KI physische Prozesse oder sogar kritische Infrastrukturen steuert, kann es Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit geben.»Hans Gersbach
Welcher Schaden kann denn durch die Anwendung von KI-Technologien entstehen?
Da gibt es eine ganze Liste von möglichen Schäden. Wenn die KI zum Beispiel physische Prozesse oder sogar kritische Infrastrukturen steuert, kann es Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit geben. Aber auch dann, wenn KI zur Manipulation des menschlichen Verhaltens eingesetzt wird oder der individuelle Datenschutz gefährdet wird.
Und welche ethischen Risiken gibt es beim Einsatz von KI?
Wenn die KI zum Beispiel eingesetzt wird, um zu entscheiden, ob jemand einen Kredit oder einen Versicherungsvertrag bekommt oder welche medizinische Behandlung jemand erhält, dann müssen einerseits soziale Bewertungen (Scoring Modelle) ganz ausgeschlossen werden und andererseits muss die KI den Anforderungen einer unverzerrten Analyse genügen.
Diskriminierung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen gibt es auch ohne KI. Kann man von der KI erwarten, dass sie ethischer ist als die Gesellschaft?
Nein, die KI sollte erst einmal so ethisch sein, wie der Standard heute ist, und sie darf deshalb existierende Standards nicht untergraben. Es gibt gut begründete Diskriminierungsverbote. Wir müssen sicher gut aufpassen, dass KI-Werkzeuge Diskriminierungen nicht verschärfen oder neue schaffen, da sie aus den existierenden Daten lernen. Allerdings eröffnet die KI auch ideale Möglichkeiten, versteckte Diskriminierungen zu erkennen, diese zu korrigieren und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen.
Was macht die Regulierung der KI im Gegensatz zu anderen Technologien so speziell?
Üblicherweise regulieren wir einzelne Sektoren wie Banken oder Versicherungen. Die KI erstreckt sich aber über die gesamte Bandbreite der Wirtschaft und sie durchdringt auch die Gesellschaft immer mehr.
Gibt es eine Blaupause für die KI-Regulierung?
Eine Blaupause gibt es nicht, da es eine sehr komplexe Regulierungsaufgabe ist. Für einzelne Elemente kann das Datenschutzgesetz als Muster dienen. Auch die Regulierung der Gentechnologie und der Risikoabwägungen sind mit gewissen Aspekten der KI-Regulierung vergleichbar.
Welche Optionen hat die Schweiz für die Regulierung von KI?
Aus Schweizer Perspektive sind wir nicht mehr auf einem freien Feld, da sowohl die USA als auch die Europäische Union bereits Konzepte für die KI-Regulierung entwickelt und umgesetzt haben. Während die Europäische Union auf eine umfassende Regulierung der KI setzt, stehen in den USA Leitlinien, eine sektorale Regulierung und die Selbstregulierung im Zentrum. Für die Schweiz ergeben sich dadurch vier Optionen: Sie kann auf KI-Regulierung verzichten und die bestehenden Regeln, zum Beispiel im Datenschutz, anwenden oder anpassen und auf Selbstregulierung setzen. Option zwei wäre eine sektorale Regulierung, z.B. im Gesundheitsbereich und im Transportbereich, wie in den USA, und im Übrigen auf Selbstregulierung setzen. Option drei wäre die Übernahme des europäischen AI Acts, der am 1. August 2024 in Kraft getreten ist. Option vier – wohl letztlich für die Schweiz naheliegend – ist es, den europäischen AI Act in bedeutenden Teilen zu übernehmen, ihn aber an einigen Stellen an Schweizer Bedürfnisse anzupassen. Der AI Act der EU geht in eine vertretbare Richtung, aber es gibt einige Bereiche, in denen man den Innovatoren und Unternehmen mehr Luft zum Atmen geben kann.
Was heisst das konkret?
Der AI Act der EU reguliert sehr umfangreich und stellt sehr hohe Anforderungen an die Unternehmen. Ausserdem ist die Dokumentationspflicht der Unternehmen umfassend. Das birgt die Gefahr, dass Innovationen sich nicht lohnen oder nicht den Marktdurchbruch erreichen. Deswegen bietet sich der Schweiz die Chance, die Regulierung innovationsfreundlicher zu gestalten. Das fängt z.B. bei grosszügigen regulatorischen Testumgebungen an, geht mit starken Freiheitsgraden für Open-Source-Lösungen weiter und es hört bei einfach gehaltenen Anforderungen an kleine und mittlere Unternehmungen auf. Wenn der Schweiz eine geschickte, rechtssichere und etwas schlankere Regulierung als der EU gelingt, ergeben sich für uns grosse Chancen im Technologiebereich. Die Schweiz hat das Potenzial, sich zu einem globalen KI-Hub zu entwickeln.
«Direkte Förderung ist immer heikel. Die Regulatoren können nicht das notwendige Wissen haben, welches Unternehmen und welche Technologie gerade förderungswürdig sind.»Hans Gersbach
Im Bereich KI gibt es viele grosse Unternehmen, die eine grosse Marktmacht haben, wie beispielsweise Microsoft oder Google. Wie geht man damit um?
Die Tendenz zur Monopolbildung ergibt sich durch die Skaleneffekte der KI-Technologie und die Netzwerkeffekte im Gebrauch der Dienstleistungen bei den Tech-Giganten. Ein starkes Wettbewerbsrecht hilft, aber meistens braucht es weitere technologische Innovationen, um den Wettbewerb wieder zu verbessern.
Wäre es dann aus europäischer Sicht klug, vielversprechende europäische KI-Unternehmen wie Mistral oder Aleph Alpha zu fördern, damit sie den Big Playern aus den USA Paroli bieten können?
Direkte Förderung ist immer heikel. Die Regulatoren können nicht das notwendige Wissen haben, welches Unternehmen und welche Technologie gerade förderungswürdig sind. Das ergibt sich erst während des Wettbewerbsprozesses und nicht schon vorher. Deutlich vielversprechender sind die Förderung der Grundlagenforschung in KI und gute Rahmenbedingungen für die Finanzierung von KI-Start-ups.
Welchen Beitrag kann die Ökonomie bei der Regulierung der KI leisten?
Die Ökonomie kann spezifizieren, was gute Innovationsräume sind. Sie kann zudem einen Beitrag leisten, was realistischerweise von Regulierung und Regulierungsbehörden erwartet werden kann und welche Auswirkungen die Regulierung hat. Schliesslich können Ökonominnen und Ökonomen helfen, das gesamtwirtschaftliche Potenzial und allfällige Gefahren der KI abzuschätzen.
Tesla-Chef Elon Musk und andere Experten aus der Tech-Szene wie Apple-Mitgründer Steve Wozniak haben ein Moratorium für die Weiterentwicklung der KI gefordert. Würde das Sinn ergeben?
Weltweit stoppen kann man die KI nicht. Wie will man China vorschreiben, was es zu tun hat? Zudem würde ein Stopp der Weiterentwicklung auch die positiven Effekte der KI ausbremsen. Besser ist es, mit einer adäquaten Regulierung zu reagieren, um gefährliche Entwicklungen zu vermeiden.
Welches Potenzial hat KI noch?
Wir erwarten einen weiteren Produktivitätsschub durch KI. Allerdings ist das Ausmass dieses Schubs im Moment noch unklar. Der nächste Schritt ist die verstärkte Steuerung der physischen Prozesse, also Maschinen oder ganze Dienstleistungen, durch KI. Das geht weit über die Erstellung von Bildern, Texten oder Videos hinaus. Das grösste Poteztial der KI ist die Übernahme von immer komplexeren Tätigkeiten, die heute von Menschen ausgeführt werden, sowohl in der Produktion als auch bei Dienstleistungen.
Ansprechpersonen
Stellvertretender Leiter KOF Institut
Makroökonomie, Gersbach
Leonhardstrasse 21
8092
Zürich
Schweiz
KOF Bereich Zentrale Dienste
Leonhardstrasse 21
8092
Zürich
Schweiz